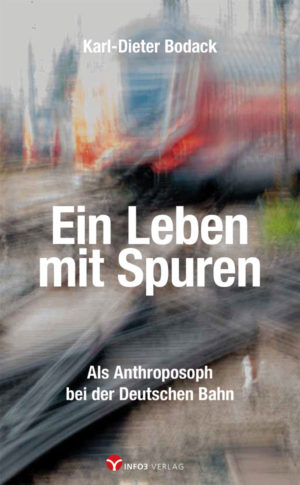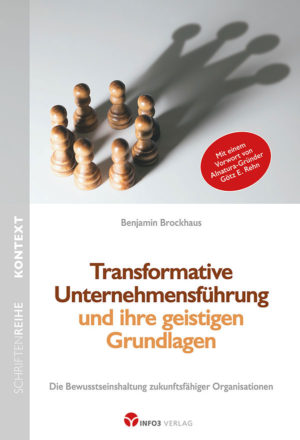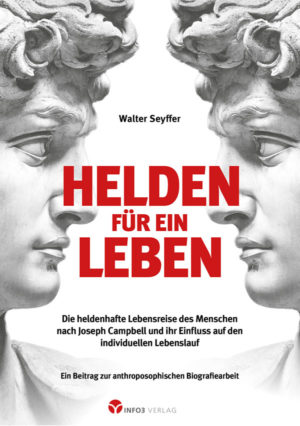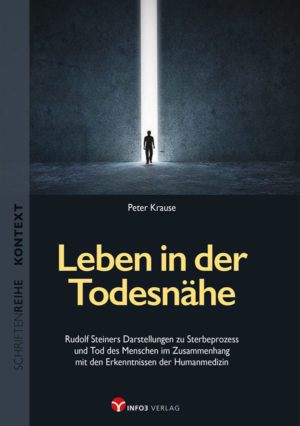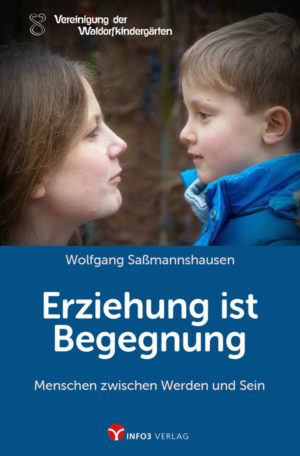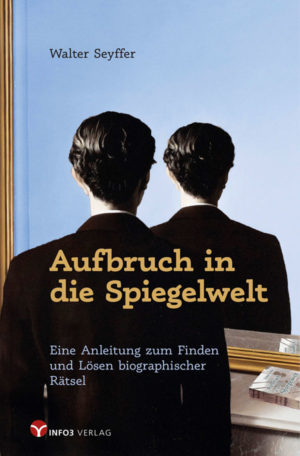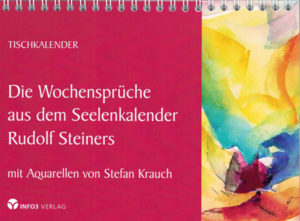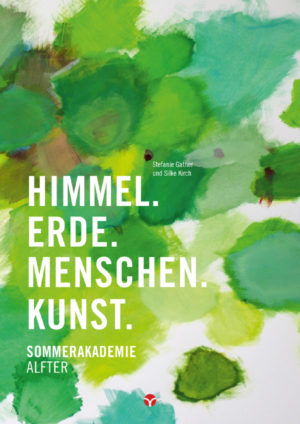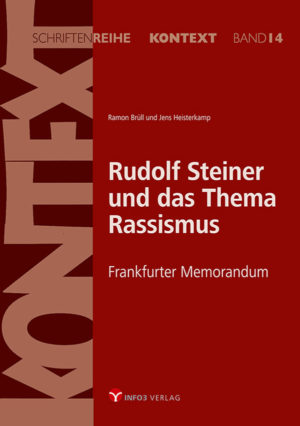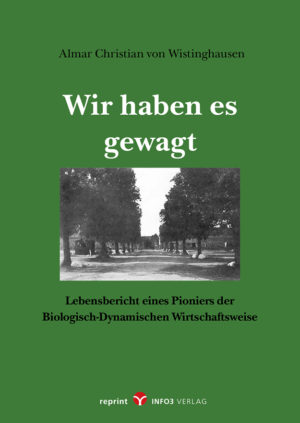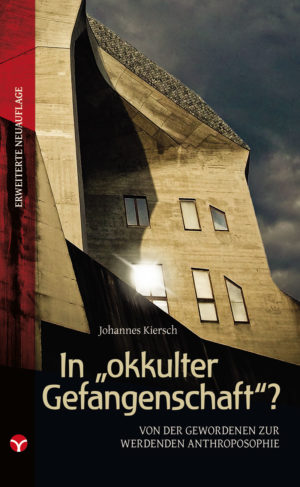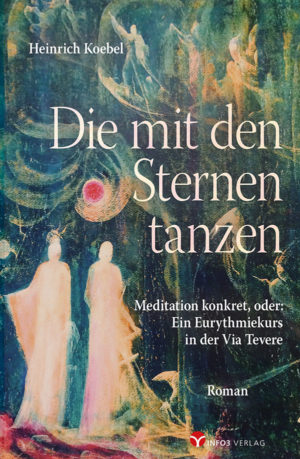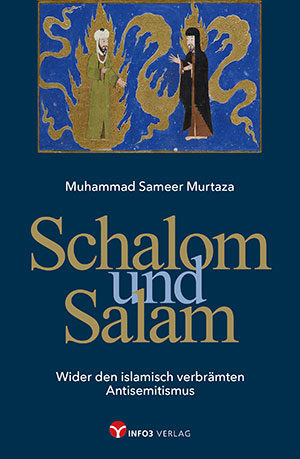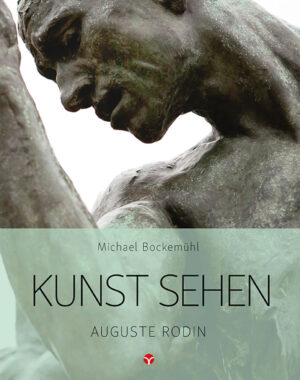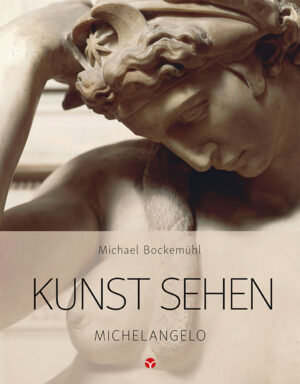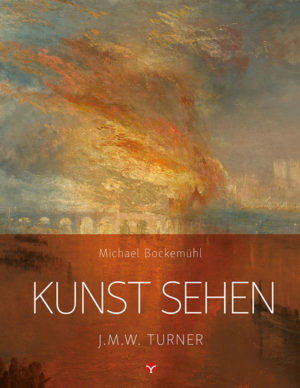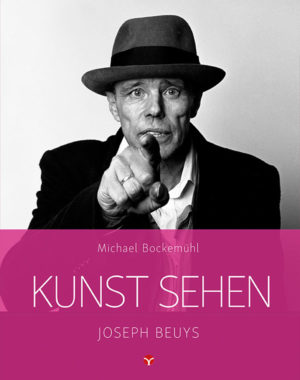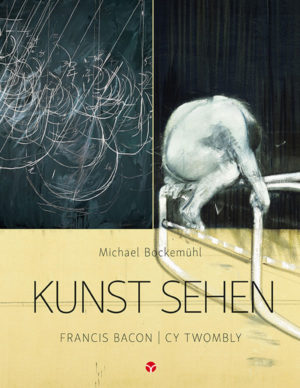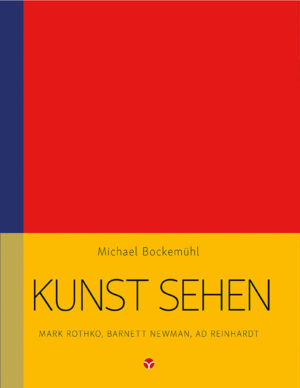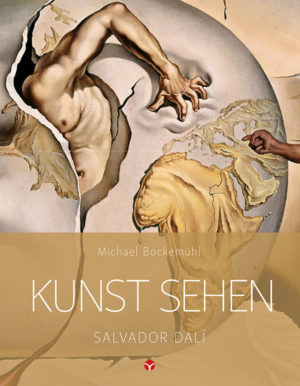Bücher
-
Karl-Dieter BodackEin Leben mit SpurenAls Anthroposoph bei der Deutschen Bahn
Autobiographie eines leidenschaftlichen Gestalters: Karl-Dieter Bodack erzählt sein Leben, eine spannende Reise mit unzähligen Stationen. Geprägt von Krieg, Flucht und Neuanfang hat der Autor bereits als junger Mensch eine Begeisterung für Technik und Gestaltung entdeckt. Er durchläuft eine Lehre an der anthroposophisch orientierten Lehrwerkstatt Hibernia in Wanne-Eickel, ein Maschinenbaustudium in Stuttgart und Kalifornien und landet bei der Deutschen Bahn.
-
Benjamin BrockhausTransformative Unternehmensführung und ihre geistigen GrundlagenDie Bewusstseinshaltung zukunftsfähiger Organisationen
Welches Menschenbild, Weltbild und welches Verständnis von Nachhaltigkeit haben die Führungspersönlichkeiten von Alnatura, GLS Bank, Lebensbaum, WALA/Dr. Hauschka und Vaude Sport?
-
Walter SeyfferHelden für ein LebenDie heldenhafte Lebensreise des Menschen nach Joseph Campbell und ihr Einfluss auf den individuellen Lebenslauf
2. Auflage April 2019
Die nach Joseph Campbell benannte „Heldenreise“ bildet ein universales Grundmuster in fast allen Mythen der Welt. Mit ihren wiederkehrenden Stufen, ihren Prüfungen, Niederlagen und Siegen bildet sie aber auch ein Gerüst, welches als Sinndimension in der Tiefe jedes menschlichen Lebenslaufes aufscheint. Walter Seyffer verbindet die von Campbell zutage geförderten Strukturen erstmals mit den Rhythmen der anthroposophischen Biographieforschung. Ausflüge in die Welt großer Kinofilme und der populären Kultur machen sein Buch höchst unterhaltsam und anregend. Aus langjähriger Erfahrung als Berater bietet Seyffer auf jeder Seite praktische Anregungen für ein fruchtbares Verständnis der „Heldenreise“ durch die eigene Biographie. -
Peter KrauseLeben in der TodesnäheRudolf Steiners Darstellungen zu Sterbeprozess und Tod des Menschen im Zusammenhang mit den Erkenntnissen der HumanmedizinDieses Buch stellt die anthroposophische Sichtweise auf Sterben und Tod in den Kontext der neueren medizinischen Forschung. Auf eindringliche Weise konfrontieren sowohl spirituelle Sichtweisen wie auch nüchtern wissenschaftliche Fakten mit der Unausweichlichkeit und Realität des Todes. Dabei gelangt der Autor zu dem überraschenden Schluss, dass bereits Rudolf Steiner den Hirntod als Tod des Menschen aufgefasst […]
-
Wolfgang SaßmannshausenErziehung ist BegegnungMenschen zwischen Werden und Sein
Wie werden pädagogische Leitbilder im Alltag mit kleinen Kindern handlungswirksam? Wie kann das Zusammenleben gelingen? Wolfgang Saßmannshausen blickt auf Erziehung als Lebenskunst und entfaltet ihr Potenzial aus der Perspektive der wechselseitigen zwischenmenschlichen Begegnung – denn beide, Kinder wie Erwachsene, sind vor allem eines: Menschen im Prozess, die sich weiterbilden und -entwickeln.
In einem Tanz von Sehnsucht und Vertrauen umspielen sie einander in ihrer auf Freiheit angelegten unverwechselbaren Individualität und erkunden das Mögliche zwischen vergangenheitsgesättigter Erfahrung und den Impulsen aus der Zukunft.
Damit Erziehung und Bildung Gegenwartserfüllung werden, braucht es die Bereitschaft, dem Strom der Zeit zu lauschen und mit Kopf, Herz und Verstand das Tor für die Zukunft zu suchen und zu öffnen. Wie die Suche gelingen kann, zeigt der Autor aus seiner langjährigen Erfahrung in diesem Buch. -
Walter SeyfferAufbruch in die SpiegelweltEine Anleitung zum Finden und Lösen biographischer Rätsel
Ein Buch für alle, die sich bewusst mit ihrer eigenen Biographie auseinandersetzen und versteckte Botschaften entdecken wollen. Mit vielen praktischen Anleitungen.
Wer sich mit dem eigenen Lebenslauf oder der Biographie anderer Menschen beschäftigt, stößt häufig auf Spiegelungs-Phänomene: inhaltlich verwandte Ereignisse beispielsweise in der Kindheit kehren im reifen Leben wieder und verweisen auf ein übergeordnetes Thema. Der Biographieberater Walter Seyffer hat solche oft verblüffenden Phänomene erforscht und zeigt, was wir aus ihnen für unsere eigene Entwicklung lernen können. Seine Überzeugung: Durch Spiegelungen signalisiert uns die Welt Interesse an unserem Weg. -
Stefan Krauch, Rudolf SteinerDie Wochensprüche aus dem Seelenkalender Rudolf SteinersTischkalender mit Aquarellen von Stefan Krauch1912 veröffentlichte Rudolf Steiner zum ersten Mal den Seelenkalender, die darin enthaltenen Sprüche sind als „Wochensprüche“„ bekannt geworden. Steiner: In diesem Kalender ist für jede Woche ein Spruch verzeichnet, der die Seele miterleben lässt, was in dieser Woche als Teil des gesamten Jahreslebens sich vollzieht. Was dieses Leben in der Seele erklingen lässt, wenn diese […]
-
Stefanie Gather, Silke KirchHimmel. Erde. Menschen. Kunst.Sommerakademie Alfter
Seit 1989 öffnet die Sommerakademie Alfter bei Bonn in den Semesterferien die Ateliers und Werkstätten der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft sowie des Alanus Werkhauses – mit Malerei, Bildhauerei, Tanz, Musik, Eurythmie, Schreibwerkstatt, Theater und experimentellen Angeboten. Als Forum für den Austausch von Jung und Alt, von bildenden und musischen Künsten ist die vierwöchige Veranstaltung selbst ein Soziales Gesamtkunstwerk.
-
Rainer PatzlaffRudolf Steiner und das „Nicht-Wort“ in der Lyrik des 20. JahrhundertsErgänzender Essay zu dem Buch „WORT(W)ENDE – Die Geburt der modernen Lyrik im 20. Jahrhundert“Der vorliegende Essay Rainer Patzlaffs – in Ergänzung zu seinem Buch Wort(w)ende – nimmt die verbürgte Sympathie Rudolf Steiners für die Lyrik des Expressionismus zum Anlass, nach einer Verwandtschaft zwischen den Zielen des Expressionismus und den Anliegen des Begründers der Anthroposophie zu fragen. Ausgehend von der Aufbruchsbewegung einer jungen Generation im beginnenden 20. Jahrhundert, die in der Figur des Jugendlichen als Hoffnungsträger des Neuen ihr Schlüsselthema fand, wird eine Nähe zu den Zielen der Anthroposophie deutlich: hier wie dort die Durchdringung der Lebenswelt mit Kunst, hier wie dort die Suche nach einer Wahrhaftigkeit, die alle Künste durchdringt. Daneben das Verstummen angesichts der Erschütterung durch den Ersten Weltkrieg und der leeren Phrasenhaftigkeit einer zu Worthülsen verkümmerten Sprache. Gerade aber das Verstummen – und darin liegt eine weitere Parallele – ermöglicht nicht allein die Ausbildung einer neuen Sprache, sondern auch die Entstehung eines neuen Wahrnehmungsorgans, das zwischen den Worten und Sätzen findet, was aus den Worten selbst ausgezogen ist. Steiners Auffassung von der Entwicklung der Sprache wird hier für die Genese moderner Lyrik produktiv gemacht.
-
Rainer PatzlaffWort(w)endeDie Geburt der modernen Lyrik im 20. JahrhundertRainer Patzlaff führt behutsam anhand von rund 40 modernen Gedichten von Hilde Domin, Rose Ausländer, Nelly Sachs und vielen anderen in die moderne Lyrik ein und zeigt auf, wie die Dichter*innen ihre Zeit verarbeiten (nicht aber von dem Zeitgeschehen determiniert werden) und zum Beispiel angesichts der Ereignisse des Ersten Weltkrieges nahezu verstummen. Das führt zu einer bisher ungekannten, nicht ohne Weiteres zugänglichen Form der Lyrik, zu einem Schweigen, zum Nicht-Wort. Patzlaff deutet an, wie sich dahinter eine anfängliche Wahrnehmung geistiger Realitäten verbergen könnte. Überraschend werden in diesem Zusammenhang auch Stellen aus Steiners Wahrspruchworte und dem Seelenkalender behandelt, wo es sich ebenso um ein Suchen nach Worten für eine Welt, die (noch) kaum beschrieben werden kann, handelt.
-
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind (Hg.)Gesichter von HochbegabungDie Vielfalt von Begabungen und TalentenDie Förderung von Begabungen ist seit vielen Jahren in die Schulpolitik und in der Schulpraxis in Deutschland fest integriert. Mit prägend für diese Entwicklung war die Arbeit der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGhK). Dennoch leidet die Umsetzung von Begabungsförderung wie jede inklusive Beschulung nach wie vor an typischen Problemen wie Zeit- und Geldmangel, […]
-
Ramon Brüll, Jens Heisterkamp (Hg.)Rudolf Steiner und das Thema RassismusFrankfurter MemorandumIm Werk Rudolf Steiners kommen vereinzelt diskriminierende und rassistische Bemerkungen vor. Auf diese wiesen und weisen Kritiker der Anthroposophie hin. Von Seiten der anthroposophischen Bewegung wurde darauf in der Regel beschwichtigend mit dem Hinweis auf Steiners humanistisches Welt- und Menschenbild reagiert. Nichtsdestoweniger wurde das Thema Rassismus bei Steiner auch innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft ernsthaft diskutiert […]
-
Peter PetersenDer Therapeut als KünstlerEin integrales Konzept von Künstlerischen Therapien und PsychotherapienKünstler ist der Therapeut nicht nur in den Künstlerischen Therapien. Jeder therapeutische Prozess basiert außer auf Lehrwissen und der Anwendung bewährter Methoden, in einem nicht geringen Maße auf Intuition und kreativem Handeln in der konkreten Arbeit mit dem Patienten. Auf der Basis seiner jahrzehntelangen Erfahrungen mit den verschiedenen Ansätzen stellt der Autor ein übergreifendes Konzept […]
-
Almar Christian von WistinghausenWir haben es gewagtLebensbericht eines Pioniers der Biologisch-Dynamischen WirtschaftsweiseEines der ersten Bücher, die wir im Info3 Verlag herausgegeben haben, war der Lebensbericht von Almar Christian von Wistinghausen: „Wir haben es gewagt“. Von Wistinghausen war 1924 der jüngste Teilnehmer am Landwirtschaftlichen Kurs Rudolf Steiners in Koberwitz und einer der Pioniere der Biologisch-Dynamischen Landwirtschaft. Das Buch beschreibt die gewagten und abenteuerlichen Anfänge von „Demeter“ im […]
-
Johannes KierschIn „okkulter Gefangenschaft“?Von der gewordenen zur werdenden AnthroposophieAnthroposophische Institutionen blühen und gedeihen. Aber das Interesse am Kern der Sache geht zurück. Der „Kulturfaktor Anthroposophie“ ist in der Öffentlichkeit weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Johannes Kiersch macht dafür weniger zivilisatorische Widerstände verantwortlich als vielmehr das Festhalten vieler Anthroposophen an überkommenden Denkformen.
-
Heinrich KoebelDie mit den Sternen tanzenMeditation konkret. Oder: Ein Eurythmiekurs in der Via TevereDer Roman zur Eurythmie Rom im Sommer, ein Studio-Raum in einem alten Haus an der via Tevere hinter einer knarrenden Holztür. Hier macht ein Kreis junger Menschen die ersten Schritte auf dem Weg in die Eurythmie. In 21 Begegnungen tun die sehr unterschiedlichen Charaktere nicht nur erste Schritte in dieser neuartigen Bewegungskunst, sondern erarbeiten sich unter Anleitung von Meister Johannes auch die großen kulturgeschichtlichen und spirituellen Zusammenhänge der Tanzform.
-
Muhammad Sameer MurtazaSchalom und SalamWider den islamisch verbrämten AntisemitismusDr. Muhammad Sameer Murtaza, geboren 1981 in Oberwesel am Rhein, studierte Islamwissenschaft mit Schwerpunkt Islamische Philosophie und Politikwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Seit 2010 ist er als erster Muslim externer Mitarbeiter der renommierten Stiftung Weltethos von Prof. Dr. Hans Küng. Dort forscht er zum jüdisch-muslimischen Dialog, über Gewaltlosigkeit aus den Quellen des Islam sowie über Gegenwartsströmungen im Islam, insbesondere zur Salafiyya. Seit dem Wintersemester 2016/2017 wirkt er auch als Lehrbeauftragter am Institut für Islamische Theologie in Osnabrück.
-
Michael BockemühlAuguste RodinBand 17 der Edition "Kunst sehen"
In dieser Vorlesung zu Rodin erfahren wir von den „Erlebnischancen in der Anschauung“, die mit einem bewussten Sehen einhergehen. Sie können uns auch Rodins Kunstauffassung näherbringen.
-
Michael BockemühlMichelangeloBand 16 der Edition "Kunst sehen"
Sehen bedarf der Ruhe, Geduld und Nähe sowie der Bereitschaft, die Perspektiven zu wechseln und (Vor-)Urteile zurückzuhalten. Ein erfrischendes Beispiel, wie das gelingen kann, finden wir in Michael Bockemühls Vorlesung zu Michelangelo, dem wohl „wirkmächtigsten Künstler der Menschheit“.
-
Michael BockemühlJ.M.W. TurnerBand 15 der Edition "Kunst sehen"
Der versierte Kunstwissenschaftler und Wahrnehmungsforscher Michael Bockemühl nimmt uns im 15. Band der Reihe KUNST SEHEN mit in die Welt eines Künstlers, der seiner Zeit weit voraus war und uns dazu anregt, über das Bild hinaus zu denken.
-
Michael BockemühlJoseph BeuysBand 14 der Edition "Kunst sehen"
Dass schöpferische Gestaltung in jedem Moment möglich ist und stets neue subversive Kraft entfalten kann, zeigt die lebendige Begegnung von Bockemühl und Beuys, die der vorliegende Band eindrücklich entfaltet.
-
Michael BockemühlFrancis Bacon, Cy TwomblyBand 13 der Edition "Kunst sehen"
Ins Bild gerät, was uns selbst kaum zugänglich ist: was mehr mit dem Werden und Entstehen, mit der Prozessualität als Lebensgrundlage inklusive ihrer abstoßenden, unförmigen, unabgeschlossenen Seiten zu tun hat.
-
Michael BockemühlMark Rothko, Barnett Newman, Ad ReinhardtBand 12 der Edition "Kunst sehen"Edition "Kunst sehen" - Band 12. Mit dem zwölften Band der Reihe Kunst Sehen rückt an die Stelle der Beobachtung der Wahrnehmungsvorgänge angesichts des Bildes eine umfassende Erfahrung, ein Eintauchen in Farbe, welche die Positionen von Subjekt und Objekt auflöst.
-
Michael BockemühlSalvador DalíBand 11 der Edition "Kunst sehen"Dalí beherrscht – wie Bockemühl zeigt – das Spiel der Irritation gewohnter Deutungsmuster meisterhaft und entlarvt das Verhältnis von Gegenstand, Vorstellung und Begriff als ein hochgradig instabiles: Seine präzise realistische Malerei sorgt für eine verblüffende Illusionsbildung.